
„Es geht um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war.“ (Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1959)
Historisch trat die Linke einmal mit dem Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an. Im Parlament der Revolutionszeit von 1789 saßen die Vertreter der Monarchie und der feudalen Gesellschaftsorganisation auf der rechten Seite des Königs. Auf der linken Seite saßen die Republikaner, die den monarchischen Staat durch einen das Volk vertretenden Staat ersetzen wollten. (S. Cagé & Piketty, 2023)
Diese, dem französischen Wortgebrauch des späten 18. Jahrhunderts nach erste Linke stand also für eine liberale demokratische Volksherrschaft. Die Vordenker dieser Linken waren die Philosophen der Aufklärung. Allen voran Voltaire und Jean-Jacques Rousseau ; die Denker der Befreiung des Volks von der Tyrannei der Kirche, der Loslösung von der Monarchie und deren Staat. (Furet, 1998)
Die aktuelle Linke arbeitet jedoch wieder an einer politischen Umkehrung dieser Positionen. Mit den Schlagworten der „Solidarität“ und der „Gerechtigkeit“ soll der Liberalismus, der die ursprüngliche Linke der französischen Revolutionäre kennzeichnete, wieder von einem staatlich verordneten Kollektivismus überholt werden. Der „demokratische Zentralismus“ von Staat und Partei scheint unseren Linken erneut als moralische Lösung politischer Probleme zeitgerecht.
1. Umstrittene Begriffe
Politische Begriffe stehen im historischen Wandel. Ihre Bedeutungen sind veränderlich, weil sie selbst Teil des politischen und geschichtlichen Kampfs um Wörter und Symbole sind.
Was Wörter wie „Demokratie“, „Liberalismus“, „Kapitalismus“, oder „Solidarität“ im Absoluten, außerhalb jeder Geschichte und jeder Politik heißen mögen, mag ein interessantes Problem für Einführungen in die politische Philosophie der Sekundarstufe darstellen.
Im real existierenden politischen Diskurs werden sie jedoch sowohl von links wie von rechts, vom Individualismus wie vom Kollektivismus, vom Kapitalismus wie vom sowjetischen Kollektivismus, von liberalen Demokraten wie von elitären Expertokraten in Anspruch genommen.
Diese Überlegungen gelten selbstverständlich auch für Gedankensysteme und ganze politische Philosophien. Mit rhetorischer Fertigkeit und begrifflicher Dreistigkeit können auch die Denker der individuellen Freiheit als Garanten kollektivistischer Diktaturen umgedeutet werden.
Die demokratische Republik Deutschlands war auf einem, von Lenin sogenannten „demokratischen Zentralismus“ gegründet, in der die sozialistische Einheitspartei wehrhafte „Rücksicht auf die Gemeinschaft“ ausübte. Auch hier war das Ziel, wie es die „Philosophie“ der neuen luxemburgischen Linken wieder fordert „immer die public happiness, für die sich der Einzelne zurücknehmen musste“ (L. Held, déi Lénk, Facebook, am 28. September 2023, eine Woche vor den Wahlen) gegen die individuellen Freiheiten durchzusetzen.
2. Die wahre Linke
Während der Pandemie wurde die Forderung eines staatlich verordneten Kollektivismus zur stärksten Forderung einer Linken, für die sich die soziale Frage inzwischen auf gerechteren Zugang zum privaten Immobilienbesitz, auf Steuergerechtigkeit und Beibehaltung der Kaufkraft beschränkt hatte.
Die Frage, wie eine „antikapitalistische“ Partei sich für mehr Privatbesitz und mehr Kaufkraft einsetzen und zugleich den „entgrenzten und individualistischen Konsum“ (L. Held, déi Lénk) anprangern kann, hat keine logische oder politische Antwort.
Links ist, was die linke Partei vertritt. Oder, wie ein Mitglied der Partei mir einmal erklärte : Wir dürfen die Wörter doch so definieren, wie es uns richtig scheint. Links ist also, was die Partei als Links ausgibt. Wer sich daran stößt, der ist kein wahrer Linker.
Man denkt hier an den bekannten Witz des „wahren Schotten“. Es handelt sich um einen bekannten Trugschluss, der darin besteht, Voraussetzungen rückwirkend immer so zu verändern, dass sie zur gewünschten „Wahrheit“ passen :
- „Kein Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei.“
- „Aber mein Onkel ist Schotte, und er streut sich Zucker auf den Haferbrei.“
- „Dann ist dein Onkel kein wahrer Schotte!“
3. Der Liberalismus der ersten Linken
Die allgemeine Bedeutungsänderung der politischen Begriffe trifft auch auf die gebräuchliche „links-rechts“ Opposition zu. Historisch war die politische Philosophie der ersten Linken diejenige des modernen Liberalismus. Der deutsche Philosoph Kant beschrieb die Prinzipien des Liberalismus der Aufklärung noch vor der Revolution auf folgende Art :
Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit ; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die : von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen : räsonniert nicht ! Der Offizier sagt : räsonniert nicht, sondern exerziert ! Der Finanzrat : räsonniert nicht, sondern bezahlt ! Der Geistliche : räsonniert nicht, sondern glaubt ! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt : räsonniert, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit.
I. Kant. 1784. Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung ?
Für den wohl bekanntesten Philosophen der Aufklärung sollte somit der Staat in erster Linie dem Zweck der Freiheitssicherung der Individuen dienen. Der Liberalismus der Aufklärung fordert die politische Doktrin der individuellen Freiheit gegen die als willkürlich empfundene Gewaltherrschaft der Kirche, der Monarchie und ihres Staats. Selbstverständlich wird man andererseits auch bei Kant selbst wieder Elemente der Disziplinierung der „wilden Freiheit“ finden, auf die sich dann später die Anhänger einer moralisierten Freiheitsbeschränkung berufen können.
Der linke Liberalismus der Französischen Revolution, der sich auch im Hinblick auf die deutsche Aufklärung verstand (Cassirer, 2022), beruhte auf einer Aktualisierung des mittelalterlichen Naturrechts (Boureau, 2002[1]). Nach diesem Rechtsbegriff setzt sich die Gesellschaft faktisch aus Individuen zusammen, die ein Recht auf ihr eigenes Leben, ihre eigenen Überzeugungen, Interessen und Lebensziele haben. Das rechtliche und politische „Sollen“ entsteht im Naturrecht aus dem „Sein“ dieser Individuen.
Jean-Jacques Rousseau war in diesem Zusammenhang als Kontenpunkt für die Politik interessant. In seinem Contrat Social (1762) versuchte er das Naturrecht auf freie Selbstbestimmung mit der staatlichen Freiheitsbegrenzung zu verbinden. Dieser Versuch erlaubte in der Folge zwei entgegengesetzte Auslegungen.
„Der Mensch ist frei geboren“ schreibt Rousseau ganz naturrechtlich gleich zu Beginn seines Contrat Social, und „auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch“ zu verzichten.
Daraus leiteten die ersten Revolutionäre die Idee ab, dass staatliche Freiheitsbeschränkung nur als freie Entscheidung von gleichberechtigten Individuen möglich sein sollte. Aber wie wir sehen werden, verstand der radikale Demokrat Robespierre Rousseau dies Idee später genau umgekehrt. (Cassirer, 2022[2])
4. Der aufgeklärte Liberalismus unserer Grundrechte
Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass dieser erste politische Liberalismus seinen Niederschlag in den Grundrechten der heutigen westlichen demokratischen Verfassungen gefunden hat.
Das Recht auf freies Leben, die Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht, die eigenen Überzeugungen und den eigenen Glauben auszusprechen und auszuüben, sofern die Ausübung dieser Rechte andere nicht davon abhält, Gleiches zu tun, und das Recht auf die freie Entfaltung der individuellen Persönlichkeit stammen alle aus dem Liberalismus der historischen Linken.
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags beschreiben den Aufklärungs-Liberalismus der Grundrechte in folgender Weise :
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sollen die Grundrechte in erster Linie die Freiheitssphäre des Einzelnen gegen Eingriffe der staatlichen Gewalt schützen und ihm insoweit die Voraussetzungen für eine freie aktive Mitwirkung und Mitgestaltung im Gemeinwesen sichern. In dieser Abwehrfunktion entsprechen sie den Menschenrechten der ersten Generation, wie sie sich in der Ideenwelt der Aufklärung und des Liberalismus entwickelt haben.
Deutscher Bundestag, 2008
5. Von links nach rechts
Die Französische Revolution erlaubt es zu illustrieren, wie schnell sich die Bedeutung der politischen Begriffe ändern kann. Die Linke, die noch 1789 für die Freiheit der Individuen stand, wandelte sich 1793, unter der Leitung von Maximilien de Robespierre, ins Gegenteil der liberalen Demokratie.
Auch Robespierre bezog sich auf Jean-Jacques Rousseau – auf seinen Begriff des „Gemeinwillens“ –, um dessen Idee des freiheitlichen Vertrags zwischen freien Individuen in einen diktatorischen Kollektivismus umzudeuten.
Mit der „guten“ Absicht, die Souveränität des Volks, die Gerechtigkeit und öffentliche Moral zu retten, proklamierte der „neue“ Linke : „Die revolutionäre Regierung schuldet den guten Bürgern den gesamten nationalen Schutz ; den Feinden des Volks schuldet sie nur den Tod“.
Selbstverständlich lag es im Ermessen der revolutionären Regierung selbst zu entscheiden, was der „Gemeinwillen“ und wer ein „guter Bürger“ oder ein „Feind“ der Demokratie war. Dieser Liberalismus der kollektiven demokratischen Solidarität wurde als die „Terrorherrschaft“ von 1793 bekannt.
Mit dem „großen Terror“ von 1794 beginnt dann auch die Geschichte der „wehrhaften Demokratie“, von der die heutigen Linken wieder von rechts außen träumen.
In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts hat auch Jacob Talmon Rousseau noch einmal in dieser Art gelesen. Im 3. Kapitel seiner Ursprünge der totalitären Demokratie von 1952, beschreibt Talmon Rousseau als einen „gequälten Paranoiker“ (Talmon, 1961, S. 35), für den die Freiheit nur in der „Zügelung irrationaler und selbstsüchtiger Triebe durch Vernunft und Pflicht“ bestehen kann. Der Gemeinwille Rousseaus lebt nach Talmon im „kollektiven Gefühl der Erhebung“ eines einmütigen Volks. So lässt der Gemeinwille dann „kein Entrinnen vor der Diktatur“. Von Rousseau führt in dieser Perspektive ein direkter Weg zur jakobinischen Diktatur, zur „Volksseele“ der Nationalsozialisten und zu Stalins Moskauer Prozessen.
6. Kollektiv mit staatlichem Sendungsbewusstsein
Für die luxemburgische Linke ist linke Politik, Politik der „Solidarität“. Aber „Solidarität“ steht heute wieder für den kollektiven Zusammenhalt einer homogenen Gemeinschaft oder eines homogenen Gemeinwillens.
In der Nachfolge von Robespierre dachte der später nationalsozialistische Verfassungsrechtler Carl Schmitt die Solidarität der wehrhaften Demokratie folgenderweise (1923):
Jede wirkliche Demokratie beruht darauf, dass nicht nur Gleiches gleich, sondern, mit unvermeidlicher Konsequenz, das Nicht-Gleiche nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.
Carl Schmitt. 2016. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus [1926].
Hieraus lässt sich der Weg der Linken von links nach rechts ermessen. Die Partei déi Lenk (zuerst „Die neue Linke“) trat nach der Veröffentlichung der Programmschrift „Abschied vom Kommunismus ? Plädoyer für einen neuen sozialen Humanismus“ als Partei für demokratisch-humanistischen Sozialismus ins Leben.
Der Autor, Gymnasiallehrer in Philosophie und langjähriges Mitglied der sowjetlastigen kommunistischen Partei, André Hoffmann, beschriebt dort, wie sich eine moderne linke Partei von der stalinistischen „Zwangskollektivierung“ lösen könne, und einen demokratischen Humanismus vertreten solle, der damals noch „Freiheit der Selbstentfaltung für ALLE“ (Hoffmann, 1992, S. 73) versprach. Präteritum !
Lesen wir noch einmal die Sätze einer der Parteigründer :
Welche Werte sind es also, die die ethische Substanz der Marxschen Theorie ausmachen – und inwieweit können sie auch heute fruchtbar bleiben oder es wieder werden ?
Es ist – auch wenn es auf den ersten Blick erstaunlich klingen mag – nicht so sehr (und jedenfalls nicht nur) die „soziale Gerechtigkeit“, die „gerechte Verteilung“. Marx hat immer wieder Kritik geübt am politischen Ziel einer illusorischen Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft, in der die FREIE ENTFALTUNG der Individuen verhindert wird.
Die Ethik von Marx ist weniger eine Ethik der „Gerechtigkeit“ als eine Ethik der FREIHEIT.
Er übernimmt gewissermaßen den beschränkten, abstrakten Freiheitsbegriff der bürgerlichen Aufklärung, der bürgerlichen Revolutionen, des Liberalismus, er konfrontiert diesen Begriff mit der sozialen und ökonomischen Wirklichkeit, mit der wirklichen Lebensweise der Individuen (der Lohnabhängigen), er weitet den Begriff aus, konkretisiert ihn, verallgemeinert ihn.“
Hoffmann, André. 1992. Abschied vom Kommunismus ? Plädoyer für einen neuen sozialen Humanismus.
Die neuen neuen „Linken“ der letzten beiden Legislaturperioden haben sich jedoch für eine andere Art von Solidarität entschieden. Das staatlich verordnete linke Kollektiv für moralische Solidarität soll sowohl die soziale Gerechtigkeit, Systemänderung, Besteuerung der Reichen, Klima- und Umweltschutz, grünen Wachstum, und somit den nachhaltigen Frieden auf Erden herbeiführen. Dafür sind aber immer neue gesellschaftliche Verbote und persönliche Verzichte unumgänglich.
Während die post-sowjetische Linke in der Nachfolge des sozialistischen Humanismus Fromms „völlige Entwicklung der menschlichen Eigenkräfte“ als Widerstand gegen die „totale Bürokratisierung“ der staatlichen Bevormundung (Fromm, 2014) forderte, hoffen die jüngeren Linken wieder auf die besseren Zeiten der Oktoberrevolution. Solidarität heißt daher wieder kollektivistisch-sowjetische Bevormundung mit „Verzicht und Verbot“.
7. Staatlichen Verbote für disziplinierte Freiheit
Der Vorwurf, die Linke sei eine Verbots- und Verzichtspartei – vergessen wir die Forderung des „Bestrafens“ nicht – ist unzutreffend, schreibt der „Philosoph“ und Listenkandidat Lukas Held auf Facebook, wortführend für die Partei.
Für den neuen linken Denker sind die staatlich (sic) angeordneten Verbote, Selbstbeschränkungen und Verzichte das legitime Mittel gegen die grenzenlose „Konsumfreiheit“ des neoliberalen Egoismus. Solidarisch sein heißt den Kampf gegen den psychologisch-moralischen „Anti-Verbot-Reflex“ des eigennützigen Ungehorsams aufzunehmen.
Wenn der sozialistische Humanist Erich Fromm dachte, dass blinder Gehorsam gegenüber der „Macht des Staates“ und der öffentlichen Meinung ein Kennzeichen des autoritären Untertanen und des verwalteten „Organisationsmenschen“ seien (Fromm, a.a.O., S. 365 – 373), behauptet die neue linke Philosophie ganz im Gegenteil, dass Ungehorsam das ausschließliche Kennzeichen der neoliberalen Selbstsucht sei.
Der liberale Egoismus und seine Konsumsucht sollen durch „progressive“ Freiheitsbeschränkung, solidarische „Affektkontrolle“ und mehr „sinnvolle Verbote“ vertilgt werden : Qui bene amat bene castigat.
So soll, laut einer anderen Listenkandidatin der Linken, dann auch die lebenswerte linke Zukunft der zukünftigen Generationen aussehen. Der egoistische Geist des Neoliberalismus soll durch den solidarischen Staat in (fast) allen seinen Formen ausgemerzt werden. Wohlgemerkt, mit der Ausnahme von Privatbesitz und Kaufkraft. Man möchte wohl nicht alle Wähler vergraulen.
Wer in solchen Plädoyers für moralisierende Staatsmacht noch Zweideutigkeiten sieht, der kann vom beseelten Kommentar eines anderen wahren Linken aus seinem „vernebelten Denken“ (L. Held) gerüttelt werden :
Einerseits wird behauptet, dass es eine Demokratie gibt, aber warum wird dann der demokratische Ermessensspielraum und die Macht des Staats auf Geheiß von Einzelpersonen eingeschränkt ? Unterliegen diese Personen nicht auch einem demokratischen Konsens ? Wahrscheinlich muss man ihnen die Etymologie der Demokratie noch einmal beibringen.
Aus der Wortherkunft leuchtet zwangsläufig ein : Die Freiheit des Staats ist unantastbar und das Individuum soll dem Staatskonsens „unterliegen“. So viel praktische Etymologie soll in der linken Demokratie sein. Ausscheidung oder Verbot des Heterogenen.
8. Es ist verboten, nicht zu verbieten !
Fasen wir also zusammen :
„Demokratie“ heißt der neuen linken Robespierre-Solidarität : Die Freiheit des Staats darf nicht mehr durch konsensunfähige neoliberale Individuen ohne Affektkontrolle eingeschränkt werden.
„Antikapitalismus“ heißt, dass die Absicherung der Kaufkraft nicht mehr dem egoistischen Konsum, sondern dem protestantischen Triebverzicht und der Affektkontrolle dient.
Und linke „Systemänderung“ heißt, dass das solidarische Zusammenleben auf den Grundmauern des moralisch gerechten Privatbesitzes aufgebaut wird : Immobilien für die Arbeiter, Steuern für die Reichen, Verzichts- und Verbotsmoral für alle.
Denn wir haben nichts zu verlieren als unsere selbst-besessene Freiheit und unsere Abwehrrechte gegen den Staat. Und wir haben eine Welt von neuen sozialistischen Ketten zu gewinnen.
Literatur
- Boureau, Alain. 2002. « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval ». Annales 57(6):1463‑88.
- Cagé, Julia, und Thomas Piketty. 2023. Une histoire du conflit politique. Elections et inégalités sociales en France, 1789 – 2022 : Elections et inégalités sociales en France, 1789 – 2022. Seuil.
- Cassirer, Ernst. 2022. „Die Idee der republikanischen Verfassung : Rede zur Verfassungsfeier.“ Am 11. August 1928. Reprint 2022. Berlin ; De Gruyter.
- Deutscher Bundestag. 2008. „Zum ‚Grundrecht auf Sicherheit‘“.
- Fromm, Erich. 2014. Sozialistischer Humanismus und Humanistische Ethik. Vol. IX. Erich Fromm : Gesamtausgabe. 19. Auflage. München : Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Furet, François. 1998. „La philosophie des Lumières et la culture révolutionnaire“. S. 153 – 67 in L’Europe dans son histoire, Histoires. Paris : Presses Universitaires de France.
- Kant, Immanuel. »Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung?« in : »Berlinische Monatsschrift«, Dezember- Heft 1784, S. 481 – 494.
- Talmon, J. L. 1961. Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schmitt, Carl. 2016. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. 10ᵉ Aufl. Berlin : Duncker & Humblot.
[1] „Die „Natur“ des Naturrechts besteht in der Tatsache, als Mensch geboren zu sein : Die Natura der mittelalterlichen Theologie bezeichnet sowohl das Wesen eines Wesens als auch das Ereignis der Geburt. […] Diese Rechte sind natürlich (da sie sich aus einer objektiven Tatsache ableiten, dass ein Mensch geboren wurde), individuell (jede Geburt ist einzigartig), subjektiv (sie sind mit diesem Individuum verbunden und bleiben unveräußerlich) und aktiv (jeder kann sie einfordern).“ (Boureau, 2002, S. 1465)
[2] Aus kritischer Sicht : „Denn bei Rousseau opfert das Individuum, indem es durch den Gesellschaftsvertrag mit anderen in Gemeinschaft tritt, sich selbst, ohne Einschränkung, dem Willen der Gemeinschaft auf. Es entäußert sich aller seiner ursprünglichen Rechte — und eben diese Entäußerung ist es, die das oberste Prinzip der Rousseauschen Staatstheorie bildet.“ (Cassirer, 2022, S. 11)
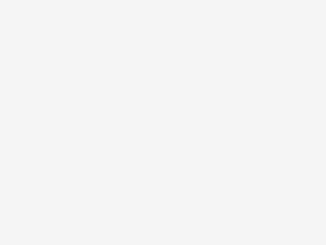


Be the first to comment