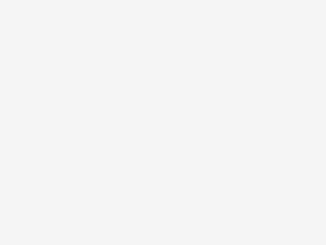Zuerst erschienen am 8. Juni 2025 im Luxemburger Wort
In einer demokratischen Öffentlichkeit ist die Sprache der Presse nicht nur ein Instrument zur Vermittlung von Fakten und unanzweifelbaren „Wahrheiten“. Meinungsfreiheit umfasst zwangsläufig auch Positionen, die sich als „falsch“ erweisen können, nicht zuletzt, weil sich politische, ökonomische und soziale Zusammenhänge in der Regel nur durch konkurrierende, unterschiedlich fundierte Interpretationen erschließen lassen.
Die Sprache der Presse ist vor allem aber auch selbst ein Teil der Wirklichkeit, die sie beschreibt. Besonders in politisch aufgeladenen Debatten scheint es zur Norm geworden zu sein, dass bestimmte Begriffe in der journalistischen Berichterstattung nicht als beschreibende Kategorien verwendet werden, sondern als diskursive Urteile. Darunter sind vor allem Begriffe wie „rechtsextrem“, „populistisch“ oder „Verschwörungstheoretiker“ zu zählen, die nicht so sehr der Aufklärung oder der Information dienen, als der Disqualifizierung von politisch unerwünschter Opposition. Dienen sogenannte journalistische „Brandmauern“ primär der Disqualifikation legitimer demokratischer Opposition, so werden sie nicht zu Bollwerken der (wehrhaften) Demokratie, sondern zu Instrumenten ihrer Abschaffung.
Der Begriff als Etikett
Der Ausdruck „rechtsextrem“ ist in medialen Kontexten zu einem etikettierenden Kampfbegriff geworden. In Ermangelung klarer Definitionen, überprüfbarer Kriterien und einer nachvollziehbaren Argumentation steht das Urteil vor der Analyse bereits fest – ein Umstand, den auch die selektive Berufung auf wissenschaftliche Autorität nicht zu relativieren vermag.
Diese Form der Begriffsnutzung hat Folgen : Sie ersetzt eine politische Auseinandersetzung durch moralische Markierung. Wer als „rechtsextrem“ benannt wird, steht nicht mehr zur Debatte, sondern außerhalb der Debatte.
Selbstverständlich gibt es tatsächlichen Rechtsextremismus in Europa. Aber die öffentliche Wirkung eines Begriffs hängt nicht nur von seiner faktischen Angemessenheit ab, sondern auch von seiner diskursiven Funktion. Und diese Funktion ist in den beschriebenen Fällen nicht analytisch, sondern strikt normativ, abwertend. Der Begriff wird hier allgemein zum abwertenden Urteil. Dies untergräbt nicht nur die Qualität der öffentlichen Debatte und die Glaubwürdigkeit des Journalismus, sondern führt letztlich zu einer Kurzschließung des demokratischen Meinungsaustauschs.
Journalistische Ethik im luxemburgischen Kontext
Der luxemburgische „Code de déontologie journalistique definiert die Rolle der Medien klar : Der Journalismus soll den Bürgerinnen und Bürgern eine faire, vielfältige und wahrheitsgemäße Information bereitstellen, den demokratischen Diskurs ermöglichen und die Voraussetzungen für kritische Urteilskraft schaffen. Zentrale Werte sind dabei Unparteilichkeit, Transparenz, und das Prinzip der Trennung zwischen Nachricht und Meinung.
Wortwörtlich heißt es dort : „Diese Freiheit, die ohne Einschränkungen, ohne Druck und ohne Zensur ausgeübt werden muss, ist eine der unverzichtbaren Säulen jeder demokratischen Gesellschaft.“
Wenn jedoch Begriffe wie „rechtsextrem“ ohne argumentative Unterfütterung verwendet werden, wird diese Unterscheidung zwischen Fakt und Urteil unscharf. Die Öffentlichkeit kann nicht mehr erkennen, ob es sich um eine analytisch begründete Einschätzung handelt, oder um eine politische Positionierung. Deshalb besteht die journalistische Verantwortung darin, diese Grenze nicht zu verwischen.
Sprache ist nie neutral. Wenn der Journalismus sich unkritisch dieser diskursiven Verwischung bedient, läuft er Gefahr, seine eigene Funktion als Aufklärer aufzugeben. Dann wird aus journalistischer Analyse politische Einordnung und aus demokratischer Kritik moralisches Tribunat.
Die Funktion der Presse in der Demokratie
Die Presse erfüllt in einer demokratischen Gesellschaft drei Hauptfunktionen : erstens die Informationsfunktion, zweitens die Kontrollfunktion, drittens die Artikulationsfunktion. Das bedeutet, dass die Presse über relevante Entwicklungen informiert, die Macht überwacht und verschiedenen gesellschaftlichen Positionen eine Stimme gibt.
Wenn diese Funktionen durch moralisch aufgeladene Begriffe und Diskurssteuerung ersetzt werden, verliert der Journalismus seine demokratische Qualität. Wer eine demokratisch gewählte Partei nicht mehr sachlich kritisiert, sondern sie pauschal etikettiert oder ausgrenzt, gefährdet den politischen Pluralismus. Auch unbequeme Stimmen sind legitimer Ausdruck des Wählerwillens. Ihre systematische Ausgrenzung durch Brandmauern der Gesinnung schwächt die demokratische Debattenkultur.
Brandmauern der Gesinnung mögen als moralisches Bollwerk erscheinen, doch in Wahrheit verhindern sie die demokratische Auseinandersetzung. Eine lebendige Demokratie benötigt keine Ausgrenzung, sondern kritischen Diskurs ; auch mit jenen, deren Ansichten man entschieden ablehnt. Sonst wird der Journalismus selbst Teil der politischen Polarisierung, die er anprangert, anstatt sie zu reflektieren.