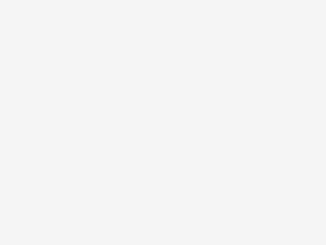(Zuerst erschienen im Magazin 1bis19.de, 14. März 2025)
2020 hat die öffentliche Debatte über die Demokratie einen überraschenden Aufschwung erfahren. Dass während der Zeit der Lockdowns die demokratischen Grundrechte der Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung und körperlichen Unversehrtheit tiefgreifend eingeschränkt wurden, galt als Ausdruck staatlich verordneter „demokratischer“ Solidarität.
Das Risiko des Naturzustands
Namhafte Denker der partizipativen und deliberativen Demokratie sahen darin eine Bestätigung der demokratischen Verfassung. Der wohl bekannteste Verfechter der demokratischen Teilhabe, der Philosoph Jürgen Habermas, stellte 2021 in dramatischem Duktus fest, unter der Bedrohung von „Leben und Gesundheit von Angehörigen der species homo sapiens überall auf dem Erdball“ befinde sich die Menschheit in einem Krieg der Spezies einem Krieg von sowohl biologischer als auch metaphysischer Tragweite. In einer solchen Situation hätten die „gesetzlich verordneten Solidarleistungen“ (Habermas, 2021) des Staates absoluten Vorrang vor den Individualrechten. Habermas meinte also : Es sei demokratisch, mehr Diktatur zu wagen. Denn Individualrechte erhielten ihren eigentlichen gesellschaftlichen Sinn erst in Gegensatz zum argumentativen Konstrukt des Naturzustandes. Der vernunftmäßige Rechtszustand gründe auf dem Vorrang der gesellschaftlichen Sicherheit gegen den fiktiven Naturzustand, wo das Leben bekanntlich „einsam, arm, grausam, brutal und kurz“ (Hobbes) sei.
Ohne gesellschaftliche Sicherheit könne es also keine Freiheit geben. Deshalb sei es demokratischer, das Leben zu erhalten, als eine menschenrechtliche Teilhabe an der Diskussion über die Gefahren und ihre Bekämpfung zu erlauben. Der demokratische Staat solle seine Bürger „mit einem temporären Rückfall unter das rechtliche Niveau reifer Demokratien“ von den Risiken eines nie dagewesenen Naturzustandes befreien. Dieser rechtliche Rückfall sichere den „Schutz des Lebens“, indem er die Prinzipien der Demokratie ausnahmsweise aufhebt, um schließlich nicht nur das Leben, sondern auch die Demokratie zu sichern. Folgt man Habermas, ist Demokratie außerstande, Gefahren und Krisen zu bewältigen. Hieße das dann aber auch, dass es nicht die Demokratie ist, die vor dem hypothetischen Naturzustand rettet, sondern eine Ordnung unter dem Niveau reifer Demokratien ?
Demokratie und Diktatur
Was unter Demokratie zu verstehen ist, das stellte das wissenschaftsjournalistische Magazin Quarks in einem Blogpost folgender Weise dar :
„In einer Demokratie legen die Menschen Gesetze für sich selbst fest. Wir entscheiden mindestens indirekt durch die Wahl – alle bei den Gesetzen mit, müssen uns aber dann auch alle selbst dran halten. Das Gegenteil sind autokratische Herrschaftsformen : Hier bestimmt eine kleine Gruppe von Menschen, oder auch nur ein Mensch, oft ein Monarch/eine Monarchin oder Diktator. Das Volk ist dann nicht selbst‑, sondern fremdbestimmt“. (Meyer-Gehlen, 2024)
Wir leben also in einer Demokratie, solange wir alle paar Jahre die Repräsentanten der politisch-demokratischen Macht frei wählen. Direkte Demokratie findet alle vier Jahre während der Dauer eines kurzen Abstechers im Wahlbüro statt. Dazwischen gilt die „indirekte“ Demokratie, wo eine kleine Gruppe von Menschen, die uns repräsentieren, die Gesetze macht. Das heißt : In einer Diktatur bestimmt eine kleine Gruppe von Menschen, was das Volk zu tun hat. In einer Demokratie bestimmt eine kleine Gruppe von Menschen, was das Volk zu tun hat, während der Zeit eines demokratischen Mandats. Was ist der Unterschied zur Diktatur ? Besteht er darin, dass die kleine Gruppe von Menschen, die Macht über die Bürger ausübt, für eine bestimmte Dauer vom Volk bestimmt wurde ? Wäre also die Demokratie demnach eine Art befristete Vierjahres-Diktatur ? Nordkorea veranstaltet alle 5 Jahre Wahlen, bei denen die oberste, repräsentative Volksversammlung, die politische Macht, von den Bürgern durch ein Ja/Nein bestimmt wird.
Das minimalistische Modell der Demokratie : Zugang der Eliten zur Macht
Der Quarks-Journalist greift hier auf das „minimalistische Modell“ der Demokratie zurück (Merkel, 2015). In Krisenzeiten vermag es sich sogar bei Denkern der partizipativen Demokratie wie Habermas durchzusetzen. Die Idee wurde primär vom österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter (1883 – 1950) geprägt. Schumpeter begriff die Demokratie als einen Markt, auf dem verschiedene politische Unternehmer ihre Programme der Nachfrage von Wählern anbieten. Der politische Wettbewerb auf dem Markt der Ideen wird eingeschränkt auf die sich in regelmäßigen Abständen wiederholenden Stimmabgaben politischer Konsumenten.
In diesem minimalistischen Modell des politischen Markts dienen die Wahlveranstaltungen dazu, die besten, die interessantesten, die wortgewandtesten oder einfach die medial wirksamsten Politikanbieter per Abstimmungsverfahren an die Macht zu bringen. Das Modell ist ein prinzipiell aristokratisches Modell (aus dem griechischen aristos = Bester)[1] . Die minimale Demokratie vereinfacht den Zugang politischer und wirtschaftlicher Eliten zur staatlichen Macht. Das konnte jeder politische Beobachter, dessen Vernunft nicht durchgehend von der „betreuenden Presse“ beschädigt war, spätestens während der Pandemiejahren und der darauffolgenden Zeit der Kriege in der Ukraine sowie Israel und Gaza seit 2022 bzw. 2023 wahrnehmen.
Die Urszene der Demokratie als Kritik an Macht und Gewalt
Solche Probleme und die daraus resultierenden Fragen sind selbstverständlich nicht neu, auch wenn sie heute systematische Züge annehmen, die zu den Anfangszeiten der modernen Demokratien des 18. Jahrhunderts nicht bekannt waren. Dennoch kann man sie prinzipiell bis in die Debatten um die amerikanische Unabhängigkeit zurückverfolgen.
Im späten 18. Jahrhundert, 4 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg, zur Zeit der Debatte um die amerikanische Verfassung, befassten sich James Madison, Alexander Hamilton und John Jay unter anderem mit genau diesen Problemen in den Federalist Papers (1787 – 88). Im Kontext der Loslösung der 13 amerikanischen Kolonien von der britischen Monarchie stellte sich für die neuen Staaten vorrangig das Problem der Macht im politischen System. Macht bedeutete für die politischen Denker der Verfassung „Herrschaft einiger Menschen über andere, die menschliche Kontrolle über das menschliche Leben : letztlich Gewalt, Zwang“ (Bailyn, 2017, S. 82).
Die Debatten über die Macht in der Demokratie sparten nicht an Metaphern. Macht hat eine natürliche Tendenz zum Übergriff. Sie ist wie ein „Ozean, der nicht so leicht Grenzen zulässt“. Sie ist auch ein „Krebsgeschwür, das sich stündlich schneller ausbreitet“. Macht ist ein Appetit, der „ruhelos, strebend und unersättlich“ ist, ein Kiefer, der „immer geöffnet“ und bereit ist zu verschlingen, was ihm begegnet. Macht ist überall im öffentlichen Leben und zerstört seine „gutartigen Opfer“ (Bailyn, S. 83). Die natürlichen Opfer der Macht sind die Freiheit, die Gerechtigkeit und das Gesetz. Trotzdem, so analysiert der amerikanische Historiker Bailyn, galt Macht damals nicht als das Böse an sich : Macht ist legitim und notwendig, um durch freiwillige Vereinbarung gegenseitiger Einschränkung aus dem Naturzustand herauszutreten. Legitim ist sie jedoch nur im Dienste der Allgemeinheit, für die sie ausgeübt wird, und zum Zweck der Freiheit. Das Risiko des Machtmissbrauchs
Das Problem war den amerikanischen Denkern also nicht die Macht an sich. Das Problem war für sie die Wirkung der Macht auf die Menschen, die sie erringen und im Namen des Staates ausüben können. Samuel Adams, der Gouverneur von Massachusetts, schrieb, dass die „Verdorbenheit der Menschen so groß ist […], dass Ehrgeiz und Machtgier, die über dem Gesetz stehen, […] die vorherrschenden Leidenschaften in den Brüsten der meisten sind“ (zitiert nach Bailyn, a.a.O.).
Machtmissbrauch stellt eine Versuchung dar, der Regierende kaum widerstehen. Aus Machtmissbrauch entsteht Despotismus, mit dem Despotismus geht die Freiheit verloren und mit der verlorenen Freiheit endet die Demokratie. Der Ausgang aus dem Naturzustand bedeutete also für die amerikanischen Revolutionäre nicht wie für Professor Habermas die despotisch-staatliche Sicherung vor Infektionsrisiken. Sie sahen den Ausgang aus dem Naturzustand als Überwindung der Gefahr einer Herrschaft einiger Menschen über andere. Die politische Ordnung sollte die Sicherheit der Freiheit organisieren. Aber diese Sicherheit durfte nicht ohne Einschränkung der staatlichen Macht entstehen. Die Verfassung der Staatenföderation sollte deshalb auf dem Prinzip der Begrenzung, Überwachung und Kontrolle des Machtapparates aufgebaut werden. Im Unterschied zum Habermas‘schen Vertrauensvorschuss in Politik (und Medien) forderten die amerikanischen Gründerväter ein prinzipielles Misstrauensvotum gegenüber dem Staat und den Regierenden.
Die Konstitution der Demokratie
„Konstitution“ sollte in diesem politischen Kontext nicht vordergründig auf ein geschriebenes Dokument oder den Begriff einer Regierungsform verweisen. Nach John Adams sollte die amerikanische Konstitution in Analogie mit der Konstitution des politischen Körpers verstanden werden. Auch hier wurde eine reiche Metaphorik verwendet : Die Konstitution stellt „bestimmte Eigenschaften der Nerven, Fasern und Muskeln, oder bestimmte Qualitäten des Blutes und der Säfte“ dar. Verschiedene dieser Organe oder Gewebe können, so Adams, „richtig als stamina vitae [dt. Lebensnerv oder Lebenskraft], oder als das Wesentliche und das Grundlegende der Konstitution bezeichnet werden […]; Teile, ohne die das Leben selbst nicht einen Augenblick erhalten werden kann“ (zitiert in Bailyn, a.a.O.). Wie sollte also eine freiheitliche Grundordnung konstituiert sein, damit die ruhelose und unersättliche Leidenschaft der Macht trotz ihrer staatlichen Konzentration in Schach gehalten werden kann ?
Demokratie als Gewalt des Stärkeren und Tyrannei der Mehrheit
Ehe James Madison (1751 – 1836) 4. und 5. Präsident der Vereinigten Staaten wurde (1809 bis 1817), befasste er sich in den Federalist Papers (1787 – 88) mit dem Problem der politischen Stabilität der Demokratie. Wenn die Gerechtigkeit das höchste Ziel einer Demokratie ist, dann müsse alles daran gesetzt werden, dass diese Gerechtigkeit nicht im demokratischen Prozess verloren geht. Madison hatte einen anderen Begriff vom Naturzustand, der durch Demokratie einhegt werden müsse, als Habermas :
In einer Gesellschaft, deren konstitutionelle Strukturen es zulassen, dass sich eine stärkere Faktion mit Leichtigkeit zusammentun und die schwächere Faktion unterdrücken kann, in einer solchen Gesellschaft kann man wahrlich sagen, es herrsche Anarchie wie im Naturzustand, wo der Schwächere nicht sicher sein kann vor der Gewalttätigkeit des Stärkeren. (Hamilton & Madison. 1788. Federalist N° 51)
Folgt man Madisons Grundgedanken, dann ist nicht jede Form von Demokratie, wie es die demokratischen Minimalisten gerne annehmen, zwangsläufig gerecht oder demokratisch. In einer Demokratie ist es immer möglich, dass stärkere Faktionen, also eine kleine Gruppe von Menschen, die von der Mehrheit gewählt wurden, eine Minorität unterdrücken. Die undemokratische Demokratie – heute würde man eine solche Variante der Demokratie als illiberale Demokratie (Zakaria, 1997) oder Postdemokratie (Crouch, 2004) bezeichnen – ist eine reale Möglichkeit jeder Demokratie.
James Madison sah die „Tyrannei der Mehrheit“ – die als Begriff gemeinhin dem französischen Adligen und Monarchisten Alexis de Tocqueville zugeordnet wird – als größtes Problem der neuen Demokratie an. Während de Tocqueville darin ein tieferes, gesellschaftliches Problem sah, dem mit institutionellen oder rechtsstaatlichen Mitteln nicht so leicht beizukommen ist, bestand für Madison diese Gefahr ausschließlich in der institutionellen Organisation der politischen Macht. Schutz durch Machtkontrolle
Wie kann man also – durch institutionelle Organisation – die demokratische Demokratie vor der tyrannischen Demokratie schützen ?
Wären die Menschen Engel (Kants „reine Vernunftwesen“), argumentiert Madison, bräuchten sie keine Regierung. Die Individuen der Gesellschaft würden von sich aus tun, was gefordert wäre, um eine gerechte Demokratie zu verwirklichen. Würden die Menschen (als „endliche Vernunftwesen“ mit nicht rationalen Triebfedern) aber wenigstens von Engeln regiert werden, gäbe es keinen Grund, einer solchen Regierung zu misstrauen.
Da aber weder die Bürger noch die regierenden politischen Vertreter Engel sind, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die politische Macht der Demokratie missbraucht wird. Deshalb ist es zwar notwendig, den Umgang der Individuen durch Gesetze zu bestimmen, aber noch wichtiger, die Macht der politischen Vertreter zu beschränken und zu kontrollieren.
Die demokratische Regierung als Verschwörung in petto
Machtkontrolle und ‑beschränkung ist für Madison das wichtigste Prinzip der konstitutionellen Organisation des demokratischen Systems. Denn wenn die Interessen und die Gelegenheiten, diese Interessen zu verwirklichen, zusammentreffen, gibt es kein Prinzip und keine Vernunft, keinen religiösen Glauben und keine moralischen Überzeugungen, die die interessierte Macht noch in Schranken halten könnte. Insofern der Staat, insofern die Regierung Zugang zur höchsten Macht einer demokratischen Gesellschaft bedeutet, ist sie auch der Ort der höchsten Gefahr. Wegen der Machtkonzentration ist im Grunde jede Regierung eine Verschwörung in petto : Individuen und Gruppen von Individuen trachten notwendigerweise danach, sich diese Macht anzueignen, um ihre Interessen, wenn auch auf Kosten der anderen Mitglieder der Gesellschaft, durchzusetzen. Wenn diese Individuen oder Gruppen die staatliche Macht erlangen, ist es ihnen ein Leichtes, alle diejenigen auszuschließen, die sich ihren Interessen entgegensetzen könnten, und alle diejenigen zu belohnen, die ihnen dabei zuträglich sind. Sie bedrohen sowohl das Gemeinwohl als auch die individuellen Rechte.
Fraktionen : Bedingung und Bedrohung der Demokratie zugleich
Wie endet die Demokratie, fragt Madison ? Durch die Bildung von Gruppen – Fraktionen – mit gemeinsamen Interessen oder Leidenschaften, die die staatliche Macht übernehmen ! Fraktionen sind ein wichtiges und unumgängliches demokratisches Instrument, die Interessen der Bürger zu vertreten. Fraktionen stiften auch Einheit und Homogenität unter den Bürgern. Aber wie Sigmund Freud es gut 130 Jahre später noch einmal feststellen wird, begründet diese Homogenität nicht nur den inneren Zusammenhang einer Gruppe von Individuen. Nach außen bedingt sie auch die Kontrolle, den Ausschluss und die Unterdrückung von rivalisierenden Fraktionen oder Individuen. Fraktionen leben demnach von der Freund-/Feind-Unterscheidung : vereinend und harmonisierend nach innen, ausgrenzend und unterdrückend nach außen.
Deshalb sind Fraktionen die Bedingung und die größte Gefahr für die Demokratie zugleich. Wenn eine die „Feinde“ ausschließende Gruppe an die Macht kommt, dann bestimmt diese die Ordnung der Gesellschaft. Sie tut dies zwar demokratisch gewählt, aber dennoch auf Kosten der Nicht-Dazugehörigen. Dieses Problem, stellt Madison 1787 fest, erklärt das wachsende Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Regierung.
Die Bürger vor der Regierung schützen
Wie kann die Bevölkerung sich vor der dieser unausweichlichen demokratischen Machtübernahme von Fraktionen schützen ? Es gibt nur zwei Lösungen : Man bekämpft entweder die Ursachen der Fraktions-Tyrannei oder ihre Wirkungen.
Die Ursachenbekämpfung kann ihrerseits zwei Wege bestreiten : Der erste Weg besteht in der Aufhebung der politischen Freiheiten, der zweite in der Vereinheitlichung der Leidenschaften und Interessen. Was die Aufhebung der politischen Freiheiten betrifft, befindet Madison, so ist das Heilmittel gefährlicher als das Übel. Eine solche Aufhebung wirkt zwar der Bildung von Fraktionen entgegen. Sie beseitigt aber mit der Bildung von Fraktionen gleichzeitig den Ausdruck der politischen Meinungsbildung.
Die Vereinheitlichung der öffentlichen Meinung, die später (1925) von Walter Lippmann in Die imaginäre Öffentlichkeit als Steuerung der öffentlichen Meinung durch die Eliten vorgeschlagen werden wird, wirft für Madison zwei zentrale Probleme auf : Die Pluralität der Meinungen, Überzeugungen, Interessen und Leidenschaften, die die Menschen von Natur aus unterscheiden, würden dadurch ausgeschlossen. Die Idee der Demokratie wäre selbst aufgehoben, denn Demokratie besteht im Streit verschiedener Interessen und Meinungen. Als politisches System stellt Demokratie das Instrument dar, die uneinheitliche Meinungs- und Interessenvielfalt gewaltlos zu verwalten, nicht zu glätten und zu entfernen.
Aus demselben Grund kann es nicht angehen, so Madison, die Bildung von Fraktionen zu unterbinden. Auch Fraktionen entstehen unvermeidlich aus der menschlichen Natur. So wird es notwendigerweise immer Zusammenarbeit zwischen Gleichgesinnten und Feindseligkeit zu Anders- und Gegengesinnten geben. Pluralität führt unumgänglich zu Streit, Zerwürfnis und dem Wunsch, Andersdenkende zu unterdrücken.
Aus diesem Grund muss man die Demokratie als wesentlich instabil ansehen. Sie von den Ursachen her zu stabilisieren – durch Versuche, die Menschen zu ändern oder die gesellschaftlichen Phänomene zu unterdrücken – das ist weder wünschenswert noch eigentlich möglich. Die Gründerväter der amerikanischen Demokratie stehen hier klar im Gegensatz zum Philosophen Habermas : Das demokratische Zusammenleben ist von Natur aus zerbrechlich und die Ursachen ihrer Anfälligkeit für Tyrannei können und sollen nicht unterdrückt werden.
Deshalb, schließt Madison, bleibt nur noch die Möglichkeit, auf die Wirkungen dieser möglichen Zerrissenheit und Feindseligkeit mit ihren jeweils autoritären Ansprüchen einzuwirken. Allein auf dieser Ebene können politische Lösungen für eine Demokratie einen Sinn ergeben. Für Madison kann es nur eine institutionelle Lösung für die Instabilität der Demokratie geben. Institutionell heißt zuallererst rechtlich : Nur eine Gesetzgebung, eine Verfassung, die es vermag, die Pluralität der Interessen und Leidenschaften auf eine gerechte Art und Weise zu regulieren, kann den Interessenkampf im Rahmen des demokratischen Systems am Leben erhalten.
Aufteilung der demokratischen Macht
Madison hatte keinen Grund zu glauben, dass Regierende oder Gesetzgeber Engel sind. Auch sie werden von Leidenschaften bewegt. Man kann nicht erwarten, dass sie bessere, vernünftigere, moralischere oder anständigere Menschen sind als andere Bürger. Eine solche Gelegenheit wie die von 2020 kann sie jederzeit in Versuchung führen. Für die Demokratie sind sie ungleich gefährlicher als ihre Kritiker.
Denn während der „Durchschnittsbürger“ keine Möglichkeit hat, die Macht eines Staates in seine Richtung zu zwingen, kann der Gesetzgeber dies mit Leichtigkeit erreichen. Er kann Andersdenkende unterdrücken, ausschließen oder allgemein benachteiligen. Machtmissbrauch, Begünstigung, Korruption, Ungerechtigkeit, Manipulation und Autoritarismus gehören zu den realen Möglichkeiten (und zur politischen Wirklichkeit) des Gesetzgebers : Sie bestimmen sein Denken und Handeln maßgeblich mit. In der Demokratie stellen Regierung und Gesetzgebung also die privilegierten Orte der Tyrannei dar, weshalb es einer größtmöglichen Aufteilung der institutionalisierten Macht bedarf :
„Die Anhäufung aller Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, in denselben Händen, sei es in denen eines Einzelnen, einiger weniger oder vieler, und sei es durch Erbfolge, Selbsternennung oder Wahl, kann zu Recht als die eigentliche Definition von Tyrannei bezeichnet werden […] Die Struktur der Regierung muss für ein angemessenes System der gegenseitigen Kontrolle und des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Abteilungen sorgen“ (Madison & Hamilton, Federalist No. 51).
Fazit : Dissens als Wesen der Demokratie
Folgt man diesen Gründervätern der Federalist Papers, dann sind die Probleme der Demokratie keinesfalls durch Vereinheitlichung und Konsens zu lösen, wie es der Philosoph Habermas meint. Sie dachten umgekehrt, die Gesellschaft müsse in ihren Überzeugungen so vielfältig und gegensätzlich wie möglich organisiert werden. Sie meinten gerade nicht (wie Habermas), die Demokratie dürfe unter das demokratische Niveau zurückfallen, um sich selbst zu retten.
Im Gegenteil : Die machtpolitisch zentral verordnete Solidarität im Handeln und der Diktatkonsens der Öffentlichkeit im Denken und Reden sollen mittels einer unumkehrbaren Aufteilung der Macht (Polyarchie) den deliberativen Prozess der Öffentlichkeit stärken und schützen. Demokratie soll ihr Fundament im Aushandeln einer Pluralität von Meinungen, Informationen und Wissen finden, nicht in der „schützenden“ Gewalt eines autoritären Staates, der entscheiden darf, wann und worüber mitbestimmende politische Teilhabe stattfinden darf.
Literatur
- Bailyn, Bernard. 2017. The Ideological Origins of the American Revolution. Fiftieth anniversary edition. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
- Conway, E. M., & Oreskes, N. (2012). Merchants of Doubt : How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. London : Bloomsbury Publishing.
- Crouch, C. (2004). Post-Democracy : A Sociological Introduction. Cambridge : Polity.
- Habermas, Jürgen. 2015. „Merkels Griechenland-Politik ist ein Fehler“. Süddeutsche.de, Juni 22.
- Habermas, Jürgen. 2021. „Corona und der Schutz des Lebens“. Blätter für deutsche und internationale Politik (September 21): 65 – 78.
- Library of Congress. „Federalist Papers : Primary Documents in American History“. https://guides.loc.gov/federalist-papers/full-text
- Manin, Bernard. 2012. Principes du gouvernement représentatif. Paris : Flammarion.
- Merkel, Wolfgang, hrsg. 2015. Demokratie und Krise : zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie. Wiesbaden : Springer VS.
- Meyer-Gehlen, Markus. 2024. « Leben in der Demokratie ». quarks.de. https://www.quarks.de/gesellschaft/demokratie/.
- Nguyen, D.-D., Murayama, A., Nguyen, A.-L., Cheng, A., Murad, L., Satkunasivam, R., & Wallis, C. J. D. (2024). Payments by Drug and Medical Device Manufacturers to US Peer Reviewers of Major Medical Journals. JAMA, 332(17), 1480 – 1482.
- Veenendaal, Wouter P. 2015. „Democracy in microstates : why smallness does not produce a democratic political system”. Democratization 22(1): 92 – 112.
- Zakaria, Fareed. 1997. „The Rise of Illiberal Democracy“. Foreign Affairs 76(6): 22 – 43.
[1] Genaugenommen sind wiederholende Wahlen sowohl aristokratisch, elitär als auch demokratisch (Manin, 2012, S. 191 – 194).